Bald bin ich bei dir | Kurzgeschichte
[ Nach unten | Zum letzten Beitrag | Thema abonnieren | Neueste Beiträge zuerst ]
Klippenspri...
Gelöschter Benutzer
Bald bin ich bei dir | Kurzgeschichte
von Klippenspringer am 13.05.2018 18:51FSK 18
© alle Rechte vorbehalten - Mai, 2018 - Klippenspringer
"Komm, Judy Schätzchen." Die sanften, geflüsterten Worte meiner Mum reißen mich zurück in die Realität und erschrocken schlage ich die Augen auf. Vor mir liegt immer noch mein Bruder Lewis.
Fast sieht es aus, als wäre nur in einem friedlichen, tiefen Schlaf. Wenn da nicht die vielen Geräte, Kabel und Schläuche wären, mit denen er verbunden ist und die es schwer fallen lassen, ihn noch so wahrzunehmen, wie er immer war: Fröhlich, energiegeladen und manchmal auch etwas nervig. Neben diesen bedrohlich aussehenden, doch für Lewis lebensrettenden - nein, man müsste eher sagen, lebenserhaltenden Geräten sieht er erschreckend schmächtig und hilflos aus.
Und an allem bin immer noch ich schuld. Ich, ich hätte dafür sorgen müssen, dass er sofort behandelt würde, dass man sich um ihn kümmerte. Aber nein - stattdessen ignorierte ich sein leises Jammern und bezeichnete ihn als Weichei, sagte, dass alles bestimmt nicht so schlimm sei wie er glaubte. Aber jetzt liegt er hier, im Krankenhaus auf der Intensivstation, seit bald acht Monaten.
Mum und Dad beteuern mir immer wieder, dass es einfach nur ein großes Unglück war und mich überhaupt keine Schuld trifft- doch ich weiß, dass sie mich einfach nur trösten wollen.
Jetzt den ganzen Rest der Zeit Trübsal zu blasen, ist unsinnig, sagen sie. Mein Bruder hätte nicht gewollt, dass wir durch ihn die Lebensfreude verlieren.
Diese Worte machen mich jedes mal ganz krank vor Wut - wie könnn sie Lewis nur so vergessen? Während wir uns ein schönes Leben machen, liegt er mutterseelenallein in irgendeinem kahlen Zimmer im Koma.
Ja, ihr habt richtig gehört. Im Mai versetzten ihn die Ärzte in ein künstliches Koma, um wenigstens eine kleine Überlebenschance bleiben zu lassen. Doch all das bringt eigentlich nichts. Ihn aufzuwecken wäre tödlich, um selbst aufzuwachen, ist er viel zu schwach. Man könnte sagen, Lewis´ Leben hängt nur noch an Maschinen, die ihn täglich mit den notwendigen Stoffen versorgen..
Vor einiger Zeit sprachen meine Eltern sogar davon, die Maschinen abstellen zu lassen.
"Aber versteh doch, Judy, er wäre sein ganzes Leben lang nur ans Bett gefesselt - wenn er überhaupt aufwachen sollte. Das bedeutet nichts als Leid für deinen Bruder, hast du darüber schon mal nachgedacht? Wir können verstehen, dass du ihn nicht verlieren möchtest, aber - soll er nicht lieber ein kurzes, dafür aber schönes Leben haben, oder ein langes voller Leid?"
Das sagte mein Dad, und noch immer kann ich nicht verstehen, wie sie nur so kaltherzig sein können. Sie wollen ihn nicht weiterleben lassen.
Vielleicht ist es aber auch richtig? Vielleicht würden wir Lewis damit wirklich einen Gefallen tun?
Tränen steigen mir plötzlich in die Augen, und ich merke, wie meine Schultern beben, bei dem Gedanken, ihn zu verlieren, und ich schluchze verbittert auf.
Oh, Lewis, warum musste das nur alles so weit kommen?
Meine Mutter nimmt mich in den Arm und streicht mir sanft über das Haar.
„Komm, es ist besser, du beruhigst dich jetzt erstmal."
Wir verlassen den Raum, gehen aus dem Krankenhaus, über den Parkplatz zum Auto. Gut so, ich will nur noch weg hier. Die ganze Fahrt über herrscht ein unsicheres Schweigen, man sieht meinen Eltern an, dass sie etwas sagen wollen, aber nicht wissen, wie und was.
Zuhause verkrieche ich mich in mein Zimmer, sperre die Tür zu und lasse mich ins Bett sinken. Ich spüre, wie mir erneut die Tränen kommen und lasse ihnen freien Lauf. Auf meinem Nachtkästchen steht ein eingerahmtes Bild von Lewis und mir. Es ist noch nicht lange her, dass mein Vater es geschossen hat, vielleicht ein Jahr. Es zeigt uns beide mit einem breiten Lachen im Gesicht, während wir unser ehemaliges Pflegepferd fütterten. Diese Sorglosigkeit macht mich einerseits fassungslos, andererseits wehmütig. Nie hätten wir damals gedacht, dass nur drei Monate später alles vorbei sein würde. Mit Lewis' Unglück hatten wir unser Leben komplett verändert. Ich nahm keinen Reitunterricht mehr und der Vertrag für unser Pflegepferd wurde gekündigt. Nach und nach wurde ich immer mehr in mich gekehrt, sprach fast nicht mehr und blockte jegliche Annäherungsversuche ab. Anfangs wurde das noch mit einem mitleidigen Seitenblick geduldet, denn „sie macht ja gerade so eine schwere Zeit durch". Doch irgendwann hatten auch meine Freunde genug, wandten sich ab und redeten nur noch hinter vorgehaltenen Händen über mich.
Bei der Erinnerung an diesen unvermittelten und radikalen Wandel wird mir plötzlich ganz kalt und mein Schluchzen verstummt. Verbitterung macht sich in mir breit. Darüber, dass es so einfach jeden treffen kann, und meistens die Falschen. Lewis hat niemandem etwas getan, womit hat er das verdient? Oder sollte ich mich besser selbst fragen, womit er eine Schwester wie mich verdient? Die ihn im Stich lässt, wenn es ihm schlecht geht. Da ist er wieder, dieser schreckliche Gedanke, der mich einfach nicht loslässt. Wenn ich ihm zugehört hätte, wenn ich einen Arzt gerufen hätte, wenn, wenn, wenn...
Mum sagt oft, es macht keinen Sinn, sich wegen längst vergangener Dinge verrückt zu machen, hinterher kann man sowieso nichts mehr ändern. Aber ich höre immerzu diese strafende Stimme in meinem Hinterkopf.
Es ist deine Schuld Judy, deine Schuld...
Mein Kopf schmerzt und ich fasse mir an die Schläfe und versuche, die Stimme aus meinen Gedanken zu verbannen. Doch anstatt nachzulassen, wird sie immer lauter, und aus einer werden viele Stimmen. Ich habe das Gefühl, in einem großen Strudel zu stecken, der mich immer tiefer zieht. Verzweifelt halte ich mir die Ohren zu und bete, dass es verstummt. Für einen Moment bilde ich mir sogar ein, das Wasser, das mich sinnbildlich mit sich zieht, rauschen zu hören und ich bekomme Panik. Was passiert mit mir? Ich versuche, meine Gedanken auszublenden und öffne die Augen, die ich, ohne es zu merken, geschlossen habe. Mit zitternden Händen greife ich nach dem Foto von meinem Bruder und mir und presse es an mein Gesicht. Das kühle Metall ist angenehm in meinem Gesicht und mein Atem beruhigt sich langsam.
Von draußen höre ich Kindergeschrei. Sie lachen und rufen sich gegenseitig Scherze zu. Am liebsten würde ich sie dafür schlagen. Wofür? Dass sie in meiner Gegenwart Spaß hatten? Schon bei kurzem Nachdenken darüber kommt mir das mehr als nur absurd vor. Aber dieser Zustand macht mich einfach fassungslos. Während nebenan Kinder sorglos spielen und lachen, sitze ich hier in meinem Bett und möchte am liebsten sterben.
Ja, das ist es. Ich will sterben.
Klack.
Das dumpfe Geräusch des Steckers, den der Arzt zieht, reißt mich aus den Gedanken, zurück in die kalte Realität. Ein Gerät piept laut und leuchtet rot. Der Weißkittel, wie ich die Ärzte nenne, schaltet es aus. Mum drückt Dads Hand ganz fest und eine Träne kullert ihr über die Wange.
„Nun hat er seinen Frieden, Mary", beruhigt mein Vater sie. Ein schwaches Nicken ihrerseits. Ich bin still. Ich kann nicht mal weinen, so leer bin ich. Es fühlt sich an, als hätte ich keine Tränen mehr. Stattdessen fühle ich einfach nur eine große Leere. Sie ist in mir, breitet sich aus, zunächst nur im Bauch, dann habe ich einen Kloß im Hals, bis ich schließlich keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Das einzige, woran ich denke, sind all die Erinnerungen, in Form von verschwommenen Kurzfilmen oder Bildern. Alle Erinnerungen, die uns verbinden – oder eher gesagt, verbunden haben. Denn der Stecker, den der Weißkittel gezogen hat, war der der lebenserhaltenden Maschine für Lewis.
Mit bebenden Schultern hebe ich den Kopf aus dem vollgeheulten Kissen. Immer wieder taucht dieses Szenario in meinem Bewusstsein auf. Und die Stille, die in diesem kleinen, düsteren Raum herrschte, es war eine Totenstille. Haha, was für ein Wortspiel, denke ich und lache verbittert.
Aber ich habe bereits einen Entschluss gefasst. Ich kann nicht so weiterleben, gefangen in dieser ewigen Depression. Ich will nur noch weg, vermissen wird mich sowieso niemand. Diese Vorstellung schmerzt unheimlich, aber nicht so sehr wie Lewis' Verlust. Er war eine der wichtigsten Personen in meinem Leben, wahnsinnig klug und hatte immer eine Lösung für meine Probleme, er hörte mir zu.
Verdammt, ich werde wieder so sentimental, dabei habe ich beschlossen, mich jetzt durch nichts mehr aus der Ruhe bringen zu lassen.
Vorsichtig öffne ich meine Zimmertür einen Spalt und stelle sicher, dass meine Eltern wirklich weg sind. Dann husche ich die Treppe hinunter durchs Wohnzimmer in die Küche, zum Medikamenteschrank. Dort habe ich sie aufbewahrt, die Tabletten, die mir den Weg weisen werden. Maximal drei Stück am Tag, hatte mich der Apotheker gewarnt. Ich öffne die Packung und schütte direkt zehn Stück in meine Hand. Mit einem Blick in die Packungsbeilage („Maximal drei Pillen täglich. Kleine Überdosen können abführend, sehr große tödlich wirken. " ) vergewissere ich mich der Effektivität. Alles, was ich noch brauche, ist ein Abschiedsbrief. Ich weiß, unheimlich kitschig, aber ich will meinen Eltern gerne noch einmal sagen, dass ich sie wirklich geliebt habe. Also suche ich mir einen Stift und ein Blatt Papier und fange an, zu schreiben:
Liebe Mum, lieber Dad.
Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch immer geliebt habe, und auch die Entscheidung, Lewis zu erlösen, nun ein wenig verstehe.
Trotzdem kann ich nicht mehr. Wenn ihr das lest, bin ich schon bei meinem Bruder.
Es tut mir leid.
Judy
Etwas knapp, aber genug. Mehr würde ich sowieso nicht aufs Papier bringen.
Mit zitternden Händen greife ich wieder nach den Tabletten. Nein, ich darf mich jetzt nicht mehr abbringen lassen. Ich habe die Entscheidung gefällt, nun muss ich es auch beenden. Ich schließe die Augen nehme alle Pillen auf einmal. Sie fühlen sich pelzig und bitter auf der Zunge an und versuche, den widerlichen Geschmack zu ignorieren. Eine nach der anderen schlucke ich sie, bis mein Mund leer ist. Bitte, denke ich, bitte lass es schnell gehen. Da spüre ich auch schon den leichten Schwindel, der mich überkommt, mich nicht mehr klar denken lässt. Mir wird schwarz vor Augen und ich verliere meinen Gleichgewichtssinn. Am Hinterkopf spüre ich einen dumpfen Schlag, anscheinend bin ich auf den Boden gefallen.
Plötzlich ist es mir, als könnte ich in der Ferne ein Gesicht ausmachen. Das ist er, das muss er sein.
Ich komme, Lewis, ich komme.
Klippenspri...
Gelöschter Benutzer
Re: Bald bin ich bei dir | Kurzgeschichte
von Klippenspringer am 13.05.2018 18:52Hey, das war meine Kurzgeschichte :))
Ich würde mich über ein kurzes Feedback sehr freuen. 
Glaceon
Gelöschter Benutzer
Re: Bald bin ich bei dir | Kurzgeschichte
von Glaceon am 03.01.2019 19:41Hallo, ich habe mir diese Geschichte gerade durchgelesen und muss sagen, dass sie inhaltlich wirklich gelungen ist und ein allgegenwärtiges Problem der Ignoranz gut darstellt. Was mir besonders gefallen hat, war die Erzählperspektive, ich konnte mich richtig hineinversetzen und im Kopf mitreden. Ebenfalls waren die Wortspiele und andere metaphorische Elemente sehr passend.
Was ich allerdings nicht gut finde, was auch Ansichtssache ist, war, dass das Ende geschlosen war und die Geschichte damit sein Ende gefunden hat. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass ich als Leser nun überlegen und interpretieren soll, ob sich die Protagonistin nun umbringt oder doch unter Entschluss weiter lebt.
Vielen dank für die schöne Geschichte, hoffentlich ließt du diese Worte hier auch :)

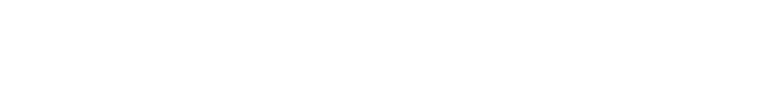
 Antworten
Antworten